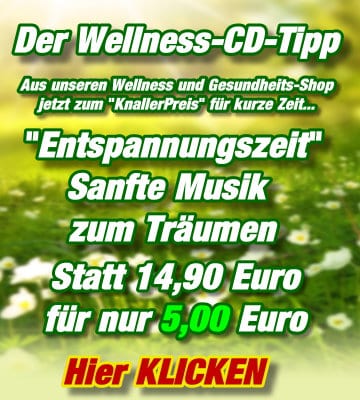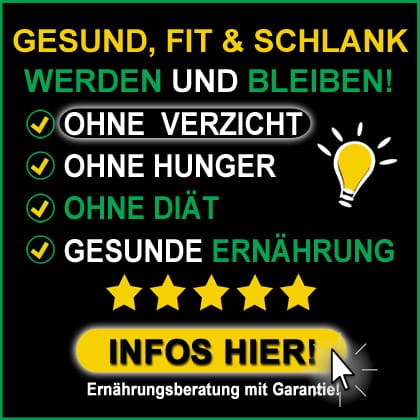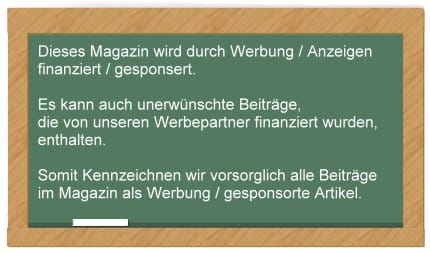Die Armut in Afrika ist menschengemacht und selten naturbedingt – Afrika steht vor großen Herausforderungen – politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Doch woran liegt das? Welche Rolle spielen die Regierungen der Länder, und welche Verantwortung trägt die internationale Gemeinschaft?
In diesem Gastartikel beleuchtet Volker Seitz, Botschafter a.D. und Autor des Bestsellers „Afrika wird armregiert“, seine Perspektive auf die Ursachen von Armut und Hunger in Afrika. Er argumentiert, dass die demografische Entwicklung, strukturelle Probleme und eine verfehlte Entwicklungspolitik zentrale Faktoren sind. Dabei plädiert er für einen neuen Ansatz, der Eigenverantwortung und nachhaltige Lösungen in den Vordergrund stellt.
📌 Hinweis der Redaktion: Dieser Gastartikel stammt von Volker Seitz, einem erfahrenen Diplomaten und Kenner der afrikanischen Entwicklungszusammenarbeit. Er beleuchtet zentrale Herausforderungen in Afrika und setzt dabei einen besonderen Fokus auf demografische Entwicklungen, Regierungsführung und die Rolle der Entwicklungspolitik. Wie bei komplexen Themen üblich gibt es unterschiedliche Sichtweisen, die diesen Diskurs bereichern. Der Beitrag soll Denkanstöße liefern und zur weiterführenden Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und Chancen Afrikas anregen.

Die wichtigste Ursache für Hunger wird so gut wie nie genannt. Der Klimawandel und bewaffnete Konflikte sind schlicht zweitrangig gegenüber dem Wachstum der Bevölkerung. Nur eine rasche Senkung des Bevölkerungswachstums wird in vielen Ländern Afrikas die Zunahme des Hungers verhindern. Hunger im Zusammenhang mit Familienplanung beschäftigt mich schon seit Jahrzehnten. Der rasche Zuwachs an Einwohnern verhindert in vielen Staaten den Aufschwung. Es ist aber ein heikles Thema, bei dem man sich rasch den Vorwurf von Rassismus einhandelt.
Hohe Geburtenraten führen Afrika zu immer mehr Arbeitslosigkeit und Armut. Die hoch gespannten Erwartungen im Wohltätigkeitsgeschäft sind in den letzten 60 Jahren im Sande verlaufen. Schulen, Brunnen, Straßen sind z. B. nach kurzer Zeit nur noch sehr eingeschränkt funktionsfähig. Grund dafür ist in der Regel das mangelnde Interesse der staatlichen Verwaltung an der Fortführung der Projekte. Was nötig ist, ist eine grundsätzliche Kehrtwende auf der Basis eigener afrikanischer Ressourcen und unser Rückzug aus der klassischen Entwicklungshilfe. Die wirkliche Hilfe beginnt mit der intensiven Förderung von Geburtenkontrolle. Weniger Geburten haben in Teilen Asiens und Südamerikas zu besseren Lebensbedingungen geführt. Die Ignoranz, wenn es um das wahre Problem Afrikas geht, finde ich erstaunlich.
Wir haben uns schon an die jährlichen dramatischen Appelle und Spendenaktionen zur Behebung akuter Ernährungskrisen in Afrika gewöhnt. Europäer, Amerikaner und Japaner spenden, um das hungrige Afrika zu versorgen. Ernährungssicherung hat in vielen afrikanischen Ländern nicht die höchste Priorität. Im Gegenteil: Die ländliche Entwicklung und Ernährungssicherung wird von den meisten Regierungen immer noch sträflich vernachlässigt. Bis heute sind nur wenige Fortschritte auf dem Kontinent erkennbar.
Ich höre oft: „Afrika leidet nicht aus eigenem Verschulden – es wird ausbeutet und betrogen.“ Möglicherweise sollten wir es mit Napoleon halten, der gesagt haben soll: „Glaube nie an eine Verschwörung, wenn schlichte Inkompetenz als Erklärung ausreicht.“

Die Länder bräuchten einen klaren Wegweiser, wie sie ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen können. Stattdessen wimmeln die Ansprachen der Verantwortlichen vor Gemeinplätzen und leeren Versprechungen. Dabei hat der Kontinent enorm fruchtbare und wasserreiche Regionen. Afrika ist der einzige Kontinent, der sich nicht selbst ernähren kann. Das war nicht immer so: Als sie unabhängig wurden, konnten die meisten Staaten ihren Nahrungsmittelbedarf selbst decken. Inzwischen sind die meisten Staaten schlecht regiert und können ihre wachsende Bevölkerung nicht mehr selbst ernähren. Was nicht produziert wird, kann nicht gegessen werden.
Der Kontinent verfügt über mehr als ein Viertel der weltweit landwirtschaftlich nutzbaren Fläche. Von den Reserven an Ackerfläche werden derzeit nur 20 Prozent überhaupt genutzt. Was nicht produziert wird, kann nicht gegessen werden. Der Weltbank zufolge ist Wachstum in der Landwirtschaft für die Armutsbekämpfung doppelt so effektiv wie in anderen Sektoren. Trotzdem wird die Problematik von Verantwortlichen, den zahllosen Hilfsorganisationen und den Medien kaum je aufgegriffen.
Von seinen natürlichen Voraussetzungen her könnte Afrika problemlos autark in seiner Nahrungs- und Energieversorgung werden. Dennoch machen Hungersnöte in Afrika gerade jetzt wieder Schlagzeilen, weil seit Jahrzehnten die ländliche und landwirtschaftliche Entwicklung vernachlässigt wurde. Gegen die stets wiederkehrenden Krisen könnten sich die Betroffenen besser wappnen. So gibt es zum Beispiel im von Dürre geplagten Äthiopien bislang kein Forschungsinstitut, das sich mit Wasser beschäftigt. Es gibt günstige, wassersparende Bewässerungssysteme, beispielsweise aus Israel, doch hapert es am Willen der Regierungen, diese Methoden durchzusetzen.
In Gegenden, wo bis zu 40 Prozent der Ernte durch unsachgemäße Lagerung wieder verloren geht, würde eine Verbesserung der landwirtschaftlichen Ausbildung helfen. In vielen Dörfern Afrikas gibt es kaum Strom, kaum Straßen, und die Bevölkerung ist – von wenigen Elitenzirkeln abgesehen – verarmt. 38 afrikanische Länder haben ein Ernährungssicherungsprogramm, aber nur Ruanda, Malawi, Ghana, Senegal und Benin haben begonnen, es in die Tat umzusetzen. Staatliche Investitionen in ländliche Infrastruktur, Logistik, landwirtschaftliche Dienstleistungen und bessere Anbaumethoden sind notwendig, um Nahrungsreserven aufzubauen. Ursachen von Katastrophen sind neben der Dürre die weltweit höchsten Geburtenraten. Gesellschaftspolitische Veränderungen gehen in Afrika zäh vonstatten. Noch ist in den Köpfen vieler in ländlichen Gebieten lebender Afrikaner eine hohe Kinderzahl gleichbedeutend mit Reichtum. Das hat für einige Länder prekäre Folgen. 7,4 Kinder gebiert eine Nigrerin durchschnittlich in ihrem Leben. Die Bevölkerung Nigers steigt bis 2030 jährlich um etwa eine Million. Dann werden es in dem Land, das zu zwei Dritteln aus Wüste besteht, 34 Millionen sein. Da 80 Prozent der Männer und Frauen über 15 Jahre weder lesen noch schreiben können, haben sie kaum Chancen auf ein geregeltes Einkommen. Sie verdingen sich als Tagelöhner, treiben mit irgendetwas Handel, bewachen etwas oder versuchen ihr Glück in Europa.

Das benachbarte Nigeria wird bis 2050 die USA als das Land mit der drittgrößten Bevölkerung hinter sich lassen. In Afrika südlich der Sahara müssen die jungen Mädchen eine bessere Schulbildung erhalten und über Verhütungsmöglichkeiten informiert werden, damit sie nicht als Jugendliche schwanger werden. Frauen, die ihre Familie planen dürfen, sind generell gesünder und besser gebildet. Auch in der Landwirtschaft hängt der Erfolg entscheidend von den Frauen ab. Je weniger Gleichberechtigung in einem Land herrscht, desto größer das Ernährungsproblem.
Die Golfstaaten, Saudi-Arabien, Bahrain, Oman, Katar, Südkorea und Indien sind Pioniere von Landwirtschaftsinvestitionen in Afrika. Drei Millionen Hektar Anbaufläche wurden gekauft oder gepachtet. Es ist eine große Dummheit, aus Gewinnsucht zum Nutzen der Nahrungsmittelsicherung anderer Nationen die eigenen Agrarflächen zur Ware zu machen, während die Staaten selbst auf den Import von Nahrungsmitteln angewiesen sind.
70 Prozent aller Afrikaner leben auf dem Land, und ihr Auskommen hängt von der Landwirtschaft ab. Oft gibt es nicht einmal einen Pflug. Der Boden wird mit einer Hacke oder Macheten bearbeitet. Kleinbauern brauchen unbedingt Zugang zu neuen Agrartechnologien, wie etwa Hybridsamen und Mineraldünger, und zu Krediten. Außerdem müssen die Barrieren für den regionalen Nahrungsmittelhandel abgebaut werden. Bildung hilft, wenn sie praxisrelevante Fähigkeiten vermittelt.
Die Ursachen der Hungersnöte auf dem Kontinent sind in der Regel menschengemacht. Länder wie z.B. Äthiopien, Kenia, Südsudan, Simbabwe geben weit mehr Geld für Waffen aus als für die Ernährungssicherung der eigenen Bevölkerung. Von dort kommen die lautesten Rufe nach Hilfe.

Das Märchen von versperrten Märkten in den Industrieländern
Auf internationalen Konferenzen verlangen Afrikaner, und mit ihnen seltsamerweise deutsche Entwicklungspolitiker, dass man die Grenzen für ihre Produkte öffnet. Da es keinen fairen Zugang zu den Märkten der Industrieländer gäbe, würden afrikanische Bauen benachteiligt und für die Regierungen würde es sich nicht lohnen, in die Landwirtschaft zu investieren. „Everything but Arms“ („Alles außer Waffen“) heißt aber ein Programm der EU, das im Jahr 2001 zur Unterstützung der am wenigsten entwickelten Länder eingeführt wurde – 34 von ihnen liegen in Afrika. Das Programm garantiert diesen Ländern den zollfreien Zugang zu den EU-Märkten für alle Güter – außer Waffen. Die Welthandelsorganisation sieht eine Ausnahme vor, die eine einseitige Marktöffnung erlaubt.
Entweder reichen die angebauten Nahrungsmittel nicht, oder die Menschen können sie sich nicht leisten. Eine produktivere Landwirtschaft könnte dazu beitragen, dass die Nahrungsmittelpreise sinken. Dort, wo Menschen hungern, wie gerade einmal mehr in Ostafrika, rufen die Regierungen nach Hilfe aus Europa oder Amerika, anstatt selbst Verantwortung zu übernehmen. Afrika, das vor 50 Jahren noch Nahrungsmittel exportierte, ist inzwischen bei der Grundversorgung abhängig von Importen und internationalen Hilfen. 300.000 Tonnen Lebensmittel müssen Jahr für Jahr eingeführt werden.
Die angolanische Volkswirtschaft ist in allen Bereichen auf Importe angewiesen. Darunter Grundnahrungsmittel wie Reis, Eier, Gemüse (Kartoffeln, Süßkartoffeln, Tomaten, Kohl, Knoblauch, Zwiebeln, Mais und Maniok) und absurderweise sogar Früchte (Mango, Bananen und Ananas). Importe aus Europa oder Brasilien sind langfristig bestimmt keine Lösung des Ernährungsproblems. Das herrschende Personal ist derzeit mehr interessiert an Billigimporten (z.B. Hühnerfleisch, Tomatenmark oder Milchpulver) zur Versorgung der politisch einflussreichen Städter, als an Förderung der politisch wenig interessanten Bauern. Nationale Machteliten neigen dazu, die Wünsche ihrer eignen ethnischen Gemeinschaft und ihrer Wählerschaft in den Städten zu erfüllen. Das hat Vorrang vor objektiven wirtschaftlichen Entwicklungszielen. Bei schwachen demokratischen Strukturen ist es schwer, Politik zur Ernährungssicherung und damit zur Armutsreduzierung voranzutreiben.

Der ehemalige Präsident Nigerias, Olusegun Obasanjo, sagt im „New African“: „People talk about poverty in Africa. God did not make Africa poor. The poverty in Africa is not God-created, it is human-made. We made Africa poor with our policies and how we execute them and how we deal with the market, the processing, and the storage of food.“ – Auf Deutsch: Die Armut in Afrika ist menschengemacht.
***
Text: Volker Seitz, Botschafter a.D. und Autor des Bestsellers „Afrika wird armregiert“ (dtv, 11. Auflage)